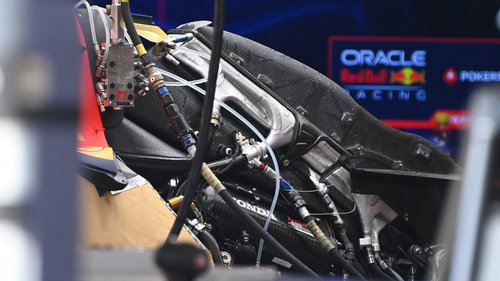Formel 1: Backstage | 02.03.2004
„Ich habe mit Tränen in den Augen meine Berichte gemacht“
Teil 2 des Gesprächs mit Heinz Prüller: Über jene Vielfalt der Formel-1-Boliden, welche früher gang und gäbe war. Und über die tragischen Verluste, welche die Königsklasse in den alten Tagen hinnehmen musste...
Michael Noir Trawniczek
Fotos: ORF (Milenko Badzic) & motorline.cc
Zur Vielfalt. Mein erstes Jahr, in dem ich so richtig die Formel 1 verfolgt habe war 1979. Da gab es eine Vielfalt bei den Autos, den Motoren. Und: Es war immer wer anderer vorne. Das Jahr zuvor dominierte der Wing Car-Lotus, doch bei den ersten beiden Rennen 1979 waren plötzlich die beiden Ligier unschlagbar.
Heinz Prüller: Ligier war erst 1980 vorne.
Nein, also das weiß ich ganz genau. Laffite hat 1979 die ersten beiden Rennen gewonnen.
Heinz Prüller: Ah, ja, richtig.
Und eben in diesem Jahr 1979 gab es ja total verschiedene Autos. Man versuchte, mit Autos wie dem Lotus 80, oder dem Brabham BT48 oder dem Arrows A2, ohne Front- und auch Heckflügel auszukommen, es gab ja die seitlichen Schürzen und das Flügelprofil unter den Autos.
Es gab auch verschiedene Motorenkonzepte: Der gängige Ford Cosworth V8-Saugmotor, aber auch einen Ferrari-12 Zylinder-Boxermotor, den anfangs belächelten Renault-Turbo, einen Alfa V12, und so weiter. Der erste Alfa-Alfa war ein klobiges seltsam aussehendes Fahrzeug. Diese ganze Vielfalt – geht Ihnen das auch ab?
Heinz Prüller: Das geht mir sehr ab, nicht nur weil bei den Autos sehr viel Kreativität im Spiel war. Ich mein’, der Sechsrad-Tyrrell und auch ein Williams hatte sechs Räder, allerdings an der Hinterachse. Oder 1971 die Frontpartie von March, Ronnie Peterson ist das Auto gefahren. Es war damals für die Konstrukteure noch möglich, eigene Kreationen zu entwerfen. Da gab es einen, der hat Lotus 88 geheißen...
Ah, der Doppeldecker.
Heinz Prüller: Ja, mit dem Doppelchassis. Die Idee dahinter war: Der Colin Chapman hat das Reglement ganz genau durchforstet und da steht nur „Lè Chassis“ und das ist Einzahl und Mehrzahl zugleich.
Und es gibt einen Passus im Reglement, dass im Zweifelsfalle die französische Version gilt, was höchst interessant ist. Weil Racing ist Englisch, Französisch ist die Sprache beim Rudern oder beim Fechten, aber im Rennsport war es immer Englisch. Das Doppeldeckerchassis ist dann verboten worden. aber die Idee von Chapman war sensationell.
Ich kann mich erinnern, der Jochen Rindt ist gefahren einen Lotus mit Allradantrieb, der inzwischen auch verboten ist. Es gab auch Turbinen, den ist Derek Walker gefahren, ein Australier, der hatte übrigens auf dem Weg zu seiner Hochzeit einen schweren Autounfall...
Warum öffnet man das Reglement nicht wieder?
Heinz Prüller: Ich habe mit dem Bernie Ecclestone oft darüber gesprochen. Der Bernie und ich sind in dem Punkt der gleichen Meinung. Eigentlich sollte man den Konstrukteuren wieder mehr Freiraum geben. Das Reglement ist einengend.
Ein wichtiges Detail ist der Windkanal. Wenn man schaut, die Mittelklasse-Autos auf der Straße sehen eigentlich fast gleich aus. Das ist die Form, die der Windkanal ergibt.
Ich habe mit der Elisabeth Junek, das war eine sehr berühmte Rennfahrerin in den Zwanzigerjahren, eine Tschechin, eine Bankiers-Gattin aus Prag, eine sehr, sehr gute Rennfahrerin, sie hatte auch immer gute Autos, einen Bugatti, gesprochen. Sie war als ältere Dame einmal in Wien. Zu den Autos im Vergleich zu früher hat sie gesagt: „Wissen Sie, Auto heute haben keine Gesichter mehr.“
Es wäre schön, wenn es wieder mehr Freiheit geben würde, dann würden die Autos sich wieder mehr unterscheiden. Es hat auch gegeben den Sigma. Das war der sogenannte Sicherheitsrennwagen. Der hat 1000 Kilo gewogen. Natürlich unmöglich, den im Rennen einzusetzen. Das sind 500 Kilo zu viel, das brauchen wir gar nicht umrechnen, das sind keine Zehntelsekunden und auch keine Sekunden, das sind ja schon Tage (Gelächter).
Das war ein Experiment, man hat versucht, ein Auto zu bauen, welches die totale Sicherheit bietet. Die heutigen Formel 1 Autos sind von den Crashtests auch so, dass sie 400 km/h Aufprallgeschwindigkeit aushalten müssen. Nur: Was da mit den Innereien eines Fahrers passiert, ist wieder eine andere Frage.
Apropos Fahrer: Sie sitzen da nun seit 30 Jahren in der Übertragungskabine, und Sie pflegen ja auch Freundschaften zu den Fahrern. Sie sehen die Piloten kommen und gehen. Früher sind noch dazu viele Fahrer gestorben...
Der Kollege Helmut Zwickl war ja auch eng befreundet mit dem Jochen Rindt und er hat erzählt, dass er nach dessen Tod mehr Distanz zum Rennsport entwickelt hat.
Wie haben Sie sich da dagegen gerüstet? Heute ist es ja nicht mehr so schlimm, aber früher war es doch so, dass wenn ein Pilot in seinen Boliden gestiegen ist, man einfach nicht wusste, ob er auch wieder von selber aussteigen wird können...
Heinz Prüller: Das stimmt. Man hat sich die Fahrer angesehen und man wusste es nicht. Der Tony Brooks hat mir erzählt: „Ich bin am Start im Auto gesessen, habe geschaut, rechts, links, vorne, hinten. Wen erwischt es heute? Ist es der neben mir? Ist es der hinter mir?“ Dass es er selber sein könnte, da denkt ja kein Fahrer dran.
Ein viel strapazierter und falsch interpretierter Ausdruck ist die „Grand Prix-Familie“ oder der „GP-Zirkus“. Es war früher eine kleinere Familie, jetzt hat die Familie ja bereits Tausende Mitglieder.
Beim Zwickl war es so, ich kann mich noch erinnern, der hat nach Monza den Flugschein gemacht. Er ist damals in eine andere Welt hinein.
Ich war ja ganz normaler Sportjournalist, der Motorsport war vielleicht zehn Prozent von dem was ich gemacht habe, ich habe Fußball gemacht, zwanzig olympische Spiele, Ski-Weltcup. Und wenn einer heute etwas über Cricket schreiben will, wird ihm der Chefredakteur sagen: „Da musst du nach England auswandern.“
Dazu muss ich eines sagen: Der Jochen Rindt war mein bester Freund. Und wir haben sehr viel miteinander geblödelt, wir haben sehr viel miteinander erlebt. Hier im Cafe Domayer sind wir gesessen und der Jochen sagte: „Schau, was da in der Zeitung steht. Da steht, eine Briefmarken-Ausstellung, die hatte 60.000 Besucher. Wie viele würden den zu einer Formel 1-Ausstellung kommen?“ Da hat er schon herumgerechnet und ich habe gesagt: „Okay, machen wir die Jochen Rindt-Show.“ Ich habe auch das erste Buch mit ihm gemacht, sein erstes Buch.
Und ich habe damals in Monza mit Tränen in den Augen meine Berichte gemacht. Ich war fürchterlich ang’soffen vor lauter Traurigkeit. Es ist ja am Samstag passiert, und mein einziger Wunsch war, dass ich am Sonntag den Grand Prix verschlafe.
Es hat mir auch körperlich weh getan. Dann bin ich aber schon um Acht munter geworden, bin nach Monza rauf, es war ein fürchterlicher Stau und ich habe gehofft, dass ich zu spät zum Grand Prix komme. Dann war ich kurz vor dem Rennen dort, hab mich in die Kabine gesetzt.
Eine steirische Zeitung hat dann darüber geschrieben, wenn auch übertrieben, aber sie haben das kapiert, wie mir also zumute war. Dass ich gekämpft habe gegen meine eigenen Zweifel am Motorsport, gegen schreckliche Kameraleute, gegen einen unfähigen Regisseur. Und sie haben auch geschrieben: „Der Held von Monza ist der Heinz Prüller.“ Das habe ich zwar nicht so empfunden, aber sie haben begriffen, wie es mir damals dabei erging.
Ich habe dann auch gesagt: Okay, ich verabschiede mich aus der Formel 1, mache wieder Fußball und Skisport. Und ich habe dann auch einen Grand Prix ausgelassen. Das war der Grand Prix von Kanada. Und ich bin dann einmal noch zur Formel 1 gefahren, das war Watkins Glen.
Ich wollte mich einfach nur von allen verabschieden. Vom Jackie Stewart. Vom Jacky Ickx, vom Jack Brabham. Das wurden ja auch gute Freunde im Laufe der Zeit. Und dann sind die meisten von ihnen zu mir gekommen und haben gesagt: „Bitte, bleib du wenigstens...“ Das habe ich mir dann über den Winter überlegt. Da hat die Annemarie Moser-Pröll schon den Weltcup gewonnen, fad wär’ mir nicht gewesen.
Aber ein halbes Jahr später war schon der Niki da, sodass ich dann weiter gemacht habe. Und es war glaube ich auch keine falsche Entscheidung. Gott sei Dank ist es jetzt doch ein bisschen sicherer geworden in der Formel 1. Es hat irgendwann einmal jemand nach einem tödlichen Unfall gesagt: „Um ihn als Rennfahrer tut mir nicht leid. Der muss wissen, was er riskiert. Aber als Mensch, als Freund tut mir das irrsinnig weh.“
1971/72 ist es ja in der Tonart weiter gegangen. Francois Cevert, dann Helmut Marko, der eine Auge verloren hatte, der Helmut Koinigg, schon wieder stirbt ein Österreicher...
Es hat viele Österreicher in der Formel 1 getroffen.
Heinz Prüller: Ja gut, aber wenn ich mir die Schweizer anschaue, der Jo Siffert ist tödlich verunglückt, der Clay Regazzoni sitzt im Rollstuhl. Man sieht dann immer das eigene Land, die eigenen Freunde. Aber jeder hat da sein Kreuz zu tragen.
Ronnie Peterson, Schweden. Der war ein Gigant. Und danach stirbt der Gunnar Nilson an Krebs, der ist ja irrsinnig tapfer gewesen. Er wollte keine schmerzstillenden Mittel, wollte im Kopf klar bleiben. Und er hat noch seine Krebs-Foundation gegründet.
Der Ronnie Peterson in Monza, acht Jahre nach Rindt, schon wieder in Monza. Es gab eine Startkollision. Ronnie hatte einen Beinbruch, sicher einen komplizierten, aber er hat gesprochen, soweit war alles in Ordnung, relativ. Und dann kommt er ins Spital, ich hätte am Sonntag heim fliegen müssen, habe das alles verschoben.
Ich bin nämlich zwei Jahre vor diesem Unfall wegen einer Knieoperation im Spital gelegen und auf einmal geht die Tür auf und es kommen rein der Ronnie Peterson, der Emerson Fittipaldi und der Clay Regazzoni. Ich hab’ geschaut. Und dann geht wieder die Tür auf und es kommt der damalige Radio-Sportredakteur Franz Krynedl rein, der mich freundlicherweise besuchen wollte. Und der sagt: „Du, entschuldige, ich habe nicht gewusst, dass hier eine Sitzung der GPDA stattfindet.“ (Gelächter).
Sag ich: „Nein...“, doch er: „Nein, da will ich nicht stören.“ Und schon war er weg. Also in Monza wollte ich dann eben den Ronnie im Spital besuchen, habe also alles verschoben. Nicht wegen Radio, Fernsehen – einfach als Freund ihn besuchen.
Und ich stehe um 6 Uhr auf, ruft der Niki Lauda an: „Du, ich hab grad einen Anruf bekommen, der Ronnie liegt im Sterben.“ Der Niki hatte das Rennen am Tag zuvor gewonnen und war schon wieder in Österreich. Sag ich: „Niki, das gibt es nicht. Der hat einen gebrochenen Fuß.“ Sagt er: „Doch, ich erhielt einen Anruf. Ich fürchte, das stimmt.“ Okay, ich sause rauf. Montag-Frühverkehr in Mailand, kennen wir ja. Schrecklich.
Dem Jochen ist es ja noch viel schlimmer gegangen, die hatten ja damals noch keinen Hubschrauber, der Jochen ist ja verblutet.
Also ich komme im Spital an. Da waren alle dreckig, wie von einer Druckerschwärze, der Arzt kommt mir entgegen mit einem schmutzigen Hemd und dreckigen Fingernagelrändern. Ich erkundige mich nach dem Ronnie Peterson. Sagt der Arzt: „Erste Tür rechts.“
Ich komme rein, liegt der Ronnie da. Wenige Minuten vorher ist er gestorben. Er war noch weich. Es war damals ausgemacht, dass er stabilisiert wird und dass man sich das am Montag genauer anschauen wird und entscheidet, wie man das dann operiert.
In der Nacht zuvor war der Arzt, der Dr. Crachales, ein Arzt aus Panama, der in Deutschland studiert und dort auch praktiziert hat und der sich eben um die Fahrer gekümmert hat, vor Ort und sagte: „Der wird stabilisiert und morgen reden wir weiter.“ Und dann haben die ohne sein Wissen in der Nacht operiert und der Ronnie ist an einer Schocklunge, wie es heißt, gestorben.
Den Unfall selber hätte er überlebt.
Heinz Prüller: Den hätte der Jochen damals auch überlebt. Der Fuß hätte ein Problem sein können, das glaube ich schon. Der Jochen hat sich ja an der Hauptschlagader verletzt. Der Jochen hat den unteren Gurt nie angezogen, weil ihn der gedrückt hat und er befürchtet hat, dass er davon impotent werden könnte.
Also diese Geschichten - das schweißt halt die Überlebenden zusammen. Obwohl, ein Journalist ist ja kein Überlebender, der hat ja auch kein Risiko. Aber es schweißt einen halt zusammen. Ich erinnere mich an ein Abendessen, damals, als der Cevert verunglückt war, mit dem Ken Tyrrell. Das war eine sehr besinnliche Atmosphäre, man hat leise gesprochen.
Oder auch als der Elio de Angelis verunglückt ist hat der Bernie Ecclestone mit dem Nelson Piquet gesprochen. Das ist dann – ich will nicht sagen feierlich, traurig ist es und es ist wahnsinnig intensiv.
Unfälle wurden ja damals nicht untersucht. Man hat nur gesagt: „Armer Kerl, schade, ja. Wer fährt jetzt in dem Auto beim nächsten Grand Prix?“ Ich habe ja den Weltkrieg Gott sei Dank nicht erlebt, zumindest nicht bewusst.
Aber mir haben viele wie der John Cooper gesagt, dass in der Formel 1 eigentlich der Krieg weiter gegangen ist. Wie im Krieg bei den Kampffliegern. Da war eine gewisse Heldenverehrung. Der Piers Courage sagte zu seinem Vater, der ihn vom Rennsport abbringen wollte: „Vater, du hattest den Krieg. Ich nicht.“
Die Teile 1, 3 und 4 des Interviews finden Sie in der Navigation rechts.