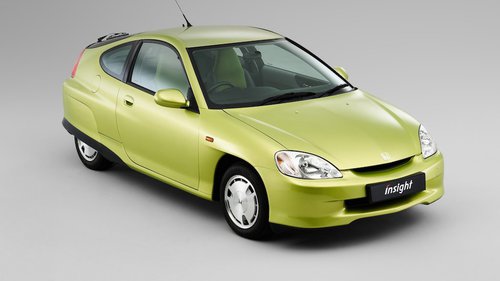Formel 1: Kuriosa | 08.01.2015
Die kürzesten Formel-1-Karrieren
In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit jenen Formel-1-Piloten, die es kaum oder gar nicht auf eine volle Renndistanz gebracht haben.
Die meisten Rennfahrer träumen von einer Karriere in der Formel 1, doch nur die wenigstens können sich diesen Wunsch erfüllen – und auch von denen, die es schaffen, verschwinden viele wieder so schnell von der Bildfläche, dass man kaum richtig Notiz von ihnen genommen hat. Einige dieser kurzen Formel-1-Karrieren dauerten nicht einmal eine Einführungsrunde lang.
Ein paar dieser Eintagsfliegen, wie Josef Peters (Grand Prix von Deutschland 1952, eine Runde), Bob Said (Grand Prix der USA 1959, eine halbe Runde) oder Graham McRae (Grand Prix von Großbritannien 1973, eine halbe Runde) hatten immerhin Erfolg in anderen Serien. Auch Marco Apicella beispielsweise fuhr in Japan im Spitzenfeld der Formula Nippon und der Super GT; Jean-Louis Schlesser war bei der Paris-Dakar und ähnlichen Marathonrallyes erfolgreich; und sowohl Sarrazin als auch Lotterer gehören sogar zu den momentan schnellsten Piloten auf der Langstrecke.
Fred Gamble, Camoradi Porsche, Grand Prix von Italien 1960, Monza; zurückgelegte Distanz: ca. 410 km
Der US-amerikanische Amateurrennfahrer Fred Gamble hatte als Funker im Zweiten Weltkrieg gedient und arbeitete als Journalist, bevor er bei einer Veranstaltung des Sports Car Club of America auf den Unternehmer Lloyd "Lucky" Casner traf. Dabei entstand ein neues Team, das Casner finanzierte. Gamble fungierte sowohl als Presseagent als auch als Gelegenheitsfahrer, neben einer Reihe anderer Piloten.
Ihr Verhandlungsgeschick ermöglichte dem Camoradi International Team jenen F2 Porsche zu ergattern, den Jean Behra vor seinem Tod auf der Berliner AVUS entwickelt hatte. Hinzu kam die reduzierte Nennliste beim Grand Prix von Italien 1960, nachdem die Organisatoren in Monza beschlossen hatten, das volle Layout der damaligen Strecke, also inklusive zweier Steilkurven, fahren zu lassen. Der Automobile Club di Milano soll deswegen kleinen Teams wie Camoradi eine Summe von 1000 US-Dollar als Startgeld angeboten haben – das konnte Casner nicht ablehnen.
Gamble qualifizierte sich als 14. der lediglich 17 angetretenen Fahrer. Er fuhr bis auf den achten Platz vor, bis er einen Boxenstopp zum Öl-Nachfüllen benötigte. Später ging ihm das Benzin aus, und er musste zu Fuß zur Boxengasse zurück, um Nachschub zu holen. Das ermöglichte ihm, weiterzumachen und – zwar mit neun Runden Rückstand auf den Gewinner Phil Hill, aber immerhin als Zehnter – das Rennen zu beenden.
Jonathan Williams, Ferrari, Grand Prix von Mexiko 1967, Mexiko-Stadt; zurückgelegte Distanz: ca. 315 km
Einen Platz bei Ferrari zu bekommen, bedeutet für einen Fahrer nicht selten eine Extremsituation. Jonathan Williams, der im August 2014 verstarb, regierte auf seine Berufung für den Grand Prix von Mexiko 1967 dennoch vergleichsweise ungewöhnlich. "Ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt", sagte er. Ferrari hatte nach Lorenzo Bandinis tödlichen Unfall den Großteil der Saison nur mit einem Auto bestritten.
Monate später wurde dem 24jährigen Williams, der für die Scuderia bereits in der Formel 2 und in Sportwagenrennen gefahren war, mitgeteilt, er solle nach Mexico-Stadt eilen und "für alle Fälle" ein paar Rennoveralls mitbringen. Nach seiner Ankunft war er während des Freitagstrainings zum Zuschauen verdonnert, am Samstag sollte er sich aber plötzlich für seinen Einsatz bereithalten. "Ich bin vorher noch nie in diesem Auto gesessen", berichtete er. "Vor dem Rennen hatte ich vielleicht 15 bis 20 Runden."
Er konnte sich dennoch als 16. von 19 Piloten qualifizieren, wenn auch über sieben Sekunden hinter der Pole-Zeit von Jim Clark. Das Rennen beendete er als Achter. Drei der Autos, die hinter ihm ankamen, waren allerdings beschädigt. "Ich habe mich danach unglaublich geschämt und habe mich hinter Sonnenbrillen versteckt, damit mich keiner erkannte", so Williams. In der Formel 1 bekam er keinen weiteren Einsatz, erzielte jedoch ordentliche Erfolge in der Formel 2 und der Sportwagen-WM, bevor er seinen Helm 1972 an den Nagel hängte.
Jean-Louis Schlesser, Williams, Grand Prix von Italien 1988, Monza; zurückgelegte Distanz: ca. 284 km
Schlesser wurde von Williams berufen, um den an Windpocken erkrankten Nigel Mansell zu ersetzen, und feierte damit sein Formel-1-Debüt einen Tag vor seinem 41. Geburtstag. "Ich war nicht überrascht, als der Anruf kam", so Schlesser. "Ich hatte bis dahin schon viele Tests absolviert. Ich hatte das Auto allerdings etwa ein Jahr lang nicht gefahren."
Williams erlebte eine furchtbare Saison, die nicht gerade dadurch besser wurde, dass der FW12 wieder auf eine passive Aufhängung zurückgebaut werden musste. Schlesser hatte Glück sich zu qualifizieren, nachdem er in der zweiten Samstagssession einen Unfall gebaut hatte. Eine Runde vor Ende des Rennens war er Elfter, als der führende Ayrton Senna aufschloss, um ihn ein zweites Mal zu überrunden – der Rest ist Geschichte.
Als Senna in der Rettifilo vorbeiziehen wollte, lenkte Schlesser ein und schubste den McLaren von der Strecke, für den daraufhin das Rennen zu Ende war. Gerhard Berger und Michele Alboreto übernahmen die Führung und schafften den Ferrari-Doppelerfolg. Es war das einzige Rennen 1988, dass nicht von einem McLaren gewonnen wurde.
"Ich war überrascht, dass er mich dort überholten wollte", so Schlesser. "Ich bremste, und bremste, und bremste, und dachte dann: 'Warum hat er noch nicht überholt?'. Ich musste dann irgendwann einlenken, und dann krachte es. Ayrton war nach dem Rennen aber gnädig mit mir. Er sagte: 'Es ist okay, keine Angst. Es war ein Rennunfall'."
Gerard Larrousse, Bretscher-Brabham, Grand Prix von Belgien 1974, Nivelles; zurückgelegte Distanz: ca. 197 km
"Ich denke, ich wollte einfach von mir behaupten können, dass ich einmal einen Grand Prix gefahren bin", sagte Gerard Larrousse vor zehn Jahren in einem Interview mit Motor Sport. Der Rallye- und Sportwagenfahrer ergatterte daher einen Platz beim Schweizer Team Bretscher-Brabham für den Grand Prix von Belgien 1974 auf der unbeliebten Strecke von Nivelles. Zuvor hatte er lediglich an vier Monoposto-Rennen teilgenommen.
"Den Boliden habe ich das erste Mal auf einem Anhänger gesehen, der von einem kleinen Laster gezogen wurde, als in Nivelles ankam", so Larrousse. "Da waren nur zwei Mechaniker." Er qualifizierte sich als 28. und schaffte es bis Runde 53, bevor seine Reifen aufgaben. Das Team hatte keinen Ersatz. "Ich habe immer vermutet, dass Leo [Mehl, damaliger Goodyear-Chef; Anm.] mir Qualifyingreifen gegeben hatte", sagte Larrousse.
Chris Craft, Grand Prix der USA 1971, Watkins Glen; zurückgelegte Distanz: ca. 163 km
Auch wenn es möglich war, mit einem gewissen Budget an der Formel 1 teilzunehmen, so gab es doch Grenzen, wie der versierte Sportwagen-Pilot Chris Craft herausfinden musste, als er 1971 den Second-Hand-Brabham von Alain de Cadenet an den Start brachte. "Mir war nicht klar, dass das Budget so knapp war, dass wir nur einen Satz Bremspedale hatten", so Craft. "Alain hatte Jack Brabhams 1970 BT33, dessen Querlenker noch immer von Jacks Unfall in Monaco verbeult war, von Ron Tauranac gekauft."
Beim Oulton Park Gold Cup, einem Nicht-WM-Lauf, wurde Craft Fünfter, und für den Grand Prix von Kanada qualifizierte er sich am Ende des Feldes, doch sein Motor gab schon in der Einführungsrunde auf. Beim finalen Grand Prix des Jahres in Watkins Glen startete er als 27., seine hintere Aufhängung brach aber schon in der 30. von 59 Runden. Das war's für Craft, aber das Auto (oder zumindest Teile davon) fuhr er noch einmal: De Cadenet baute den BT33 zu seinem gleichnamigen Le-Mans-Prototypen um.
Stéphane Sarrazin, Minardi, Grand Prix von Brasilien 1999, Interlagos; zurückgelegte Distanz: ca. 137 km
Der Formel-3000-Spitzenreiter Sarrazin testete gerade für Prost in Montmeló, als er den Anruf bekam, er könne den verletzten Luca Badoer für den Grand Prix von Brasilien ersetzen. "Ich erinnere mich, als sei es gestern gewesen", berichtet er. "Als ich ankam, trug das Ersatzauto noch Marc Genés Namen. Im freien Training war es nass, und ich wurde 14. Dann haben sie den Namen auf dem Auto geändert, und schon hat es sich ganz anders angefühlt."
"Im Rennen lief es nicht schlecht. Ich war vor Panis, der Sechster wurde. Ich lag vor einem Benetton und hatte das Gefühl, eine gute Leistung abzuliefern. Dann brach der Frontflügel, was ich zunächst gar nicht bemerkte. Ich kam zur Kurve 14 und hatte plötzlich keinen Abtrieb mehr, also fuhr ich geradeaus in die Mauer. Das war heftig. Minardi hatte zu der Zeit viele Probleme mit den Flügeln."
Da er dachte, er hätte einen Sitz bei Prost für das Jahr 2000 sicher, schlug Sarrazin das Angebot aus, bei Minardi zu bleiben. Ein Fehler, denn Prost holte Nick Heidfeld in die Formel 1, und Sarrazin verblieb in der Formel-3000-EM. "Es war meine Entscheidung", sagt er. "Ich war noch jung, gerade einmal 22, 23, und hatte keinen Manager. Ich hätte in der Formel 1 bleiben und mir einen Anwalt besorgen sollen!"
Clemente Biondetti, Grand Prix von Italien 1950, Monza; zurückgelegte Distanz: ca. 107 km
Biondetti hatte für Maserati bereits vor dem Krieg an Rennen teilgenommen und die Mille Miglia viermal gewonnen. Sein seltsamstes Abenteuer erlebte er jedoch beim Grand Prix von Italien 1950, an dem er in einem von einem Jaguar-Motor angetriebenen Ferrari teilnahm.
"Sein Starrsinn und seine Hartnäckigkeit, Charakteristiken des alten Viareggio-Stamms, sind bei Straßenrennen mehr zum Ausdruck gekommen als auf der Rennstrecke", schrieb Enzo Ferrari in seinem Buch "Piloti, che gente". Vielleicht konnte sich Biondetti deshalb nicht in einem Formel-1-Auto durchsetzen, obwohl er sowohl die Mille Miglia als auch die Targa Florio jeweils in Maschinen von Enzo Ferrari gewinnen konnte.
Er konnte Jaguar weder davon überzeugen, ihm ein Formel-1-Auto zu bauen oder wenigstens einen neuen Motor zu liefern, noch zog man ihn als Jaguar-Werksfahrer in der Sportwagenweltmeisterschaft in Betracht. Stattdessen nahm er einen gebrauchten XK120-Motor, der bei der Targa Florio einen Pleuelstangendefekt hatte, und setzte ihn zusammen mit dem Antrieb in das Chassis eines Ferrari 166 ein, der zudem vermutlich überwiegend aus Maserati-Teilen bestand ...
Mit seinem derart zusammengesetzten Auto qualifizierte sich Biondetti als 25. von 27 Fahrern, allerdings 32 Sekunden hinter der Pole-Zeit von Fangio. Er kam bis auf Position 18 nach vorne, bis sein Motor in der 17. Runde den Geist aufgab. Krankheitsbedingt musste Biondetti das Rennfahren 1954 aufgeben. Im darauffolgenden Februar verstarb er im Alter von 56 Jahren an Krebs.
Markus Winkelhock, Spyker, Grand Prix von Europa 2007, Nürburgring; zurückgelegte Distanz: ca. 77 km
Als einziger unter den Formel-1-Solisten konnte Markus Winkelhock den einen Grand Prix, an dem er teilnahm, auch anführen. Der 27jährige wurde von Spyker zum Grand Prix von Europa 2007 an den Nürburgring berufen, um Christijan Albers zu ersetzen, der rausgeschmissen wurde, nachdem sein Sponsorenvertrag ausgelaufen war.
Dank eines Strategiepokers war Winkelhock der einzige auf Regenreifen, als in der Einführungsrunde plötzlich ein Platzregen einsetzte. Während die anderen an die Box eilten, um sich mit Intermediates zu versorgen (oder beim Versuch, dorthin zu kommen, abflogen), konnte er die Führung übernehmen.
Auch nach dem Neustart führte er noch kurz, bevor in Runde 15 seine Hydraulik aufgab, und er niemals wieder in der Formel 1 fuhr. Sakon Yamamoto und seine gefüllte Brieftasche übernahmen den Platz für den Rest der Saison. "Ein Formel-1-Rennen anzuführen kann dir niemand nehmen", so Winkelhock. "Das bleibt dir ein Leben lang."
Hans Heyer, ATS-Penske, Grand Prix von Deutschland 1977, Hockenheim; zurückgelegte Distanz: ca. 61 km
Der Tourenwagenfahrer und einmalige Formel-1-Teilnehmer Hans Heyer hatte sich für den Grand Prix von Deutschland 1977 nicht einmal qualifiziert, parkte seinen ATS-Penske aber am Sonntag Nachmittag am Boxengassenausgang für den Fall, dass einer der Wettbewerber es nicht in die Startaufstellung schaffen würde. Als erster Ersatzfahrer war ihm das erlaubt.
Als Clay Regazzoni und Alan Jones in der ersten Rennrunde kollidierten, nutze Heyer seine Chance und stürzte sich ins Gefecht. Die Zuschauer waren begeistert, die Rennleitung weniger. Da sich Heyers Schaltgestänge jedoch schon nach neun Runden verabschiedete, wurde ihr die Entscheidung abgenommen, wie sie mit seinem Verstoß umgehen sollte. Sie strich ihn jedoch aus dem offiziellen Rundenprotokoll.
Tiff Needell, Ensign, Grand Prix von Belgien 1980, Zolder; zurückgelegte Distanz: ca. 51 km
Damals war er Gelegenheitsrennfahrer mit guter Formel-3-Ausbildung, heute ein anerkannter Fernsehmoderator in Großbritannien: Tiff Needell ergatterte jenen Sitz bei Ensign, der nach Clay Regazzonis Unfall in Long Beach frei geworden war. Nach einem kurzen Test in Donington Park bestritt er sein Debüt in Zolder, wo er sich als Vorletzter noch vor Emerson Fittipaldi qualifizierte.
"Ich erinnere mich, wie ich in der Startaufstellung stand und die Grand-Prix-Titelmelodie [der BBC-Übertragungen; Anm.] summte", sagt er. "Und ich konnte es mit Emerson aufnehmen, meinem Kindheitsidol!" Needells Motor ging nach zwölf Runden hoch, und er versäumte es, am nächsten Rennen in Monaco teilzunehmen, nachdem er dort im Qualifying einen Unfall gebaut hatte. Jan Lammers übernahm daraufhin seinen Platz, obwohl auch er sich im Qualifying schwer tat.
Lance Reventlow, Grand Prix von Belgien 1960, Spa-Francorchamps; zurückgelegte Distanz: ca. 14,5 km
Als Sohn der Woolworth-Erbin Barbara Hutton und mit einer Reihe von Stiefvätern, unter denen auch Cary Grant war, brachte Reventlow während seiner letztendlich vergeblichen Versuche, mit seinem in den USA entwickelten Scarab-Autos anzutreten, etwas Glamour ins damalige Formel-1-Fahrerlager.
Nachdem er im Sportwagenbereich bereits Erfolge feiern konnte, kam er mit seinen schicken, aber schwerfälligen Boliden vielleicht zwei Jahre zu spät in die Formel 1, denn die frontbetriebenen Autos, die ihm und Chuck Daigh zur Verfügen standen, kamen zu einer Zeit, in der diese Roadster-Konfiguration gerade von den Rennstrecken verschwand. Reventlow hatte es verpasst, sich in Monaco zu qualifizieren und zog seine Autos vom Grand Prix der Niederlande zurück, nachdem die Organisatoren bekanntgaben, dass nur die ersten 15 in der Startaufstellung ein Startgeld erhalten würden.
In Belgien schaffte er es jedoch an den Start: 19,7 Sekunden hinter der Pole-Zeit von Jack Brabham! Ihm gelang eine volle Runde, bevor sein Motor aufgab, als er gerade bergauf in der Eau Rouge beschleunigen wollte. Die Technik musste überdacht werden. Scarab entwickelte daraufhin Autos mit Motoren im Heck, kehrte aber nie in die Formel 1 zurück. Mit zunehmendem Alter verlor Reventlow überdies das Interesse am Rennfahren.
André Lotterer, Caterham, Grand Prix von Belgien 2014, Spa-Francorchamps; zurückgelegte Distanz: ca. 13,4 km
Als Gewinner der 24 Stunden von Le Mans und regelmäßiger Spitzenreiter in der japanischen Super Formula hatte André Lotterer in der "Königsklasse" wenig zu beweisen. Nachdem er aber schon früh in seiner Karriere (2002) Formel-1-Erfahrungen als Jaguar-Testfahrer gesammelt hatte, konnte er dem Angebot, beim Grand Prix von Belgien 2014 für Caterham zu fahren, nicht widerstehen.
Der unterlegene Formel-1-Bolide stellte sich in Sachen Kurvenfahrverhalten im Vergleich zu seinem LMP1-Audi als Enttäuschung heraus. Er konnte jedoch seinen Teamkollegen Marcus Ericsson auf Anhieb in Training und Qualifying schlagen. Sein Rennen dauerte dann nur eine Runde, bevor sein Motor an Leistung verlor, und er das Auto in der Blanchimont abstellen musste. "Es ist schade, dass ich das Rennen nicht beenden konnte", so Lotterer. "Aber ich konnte glücklich nach Hause gehen, auch wenn es nicht so endete, wie ich es gerne gehabt hätte."
Arthur Owen, Grand Prix von Italien 1960, Monza; zurückgelegte Distanz: ca. 3,2 km
Der Grand Prix von Italien wurde 1960 von den bedeutenden Teams Lotus, Cooper und BRM boykottiert, da sie die Sicherheit wegen der Nutzung der Steilkurven in Monza gefährdet sahen. Arthur Owen, ein erfahrener Bergrennfahrer, konnte der Versuchung jedoch nicht widerstehen.
Lediglich 17 Autos traten an und nur 16 gingen an den Start, da sich Jack Fairman in letzter Sekunde entschied, den Boykott mitzutragen. Owen qualifizierte sich in einem zwei Jahre alten Cooper-Climax T45 als Elfter und war damit das langsamste der neun Formel-1-Autos und lag hinter den Formel-2-Boliden von Wolfgang Berghe von Trips (Ferrari) und Hans Herrmann (Porsche).
Es gelang ihm, an Herrmann vorbeizuziehen, die erste Steilkurve erreichte er aber nicht. Bereits in der Parabolica blockierten seine Reifen, und er kam aufs Gras, was seine Aufhängung beschädigte. Owen kehrte daraufhin zu den Bergrennen zurück und gewann 1962 die britische Meisterschaft.
Miguel Angel Guerra, Osella, Grand Prix von San Marino 1981, Imola; zurückgelegte Distanz: ca. 500 Meter
Der argentinische Formel-2-Fahrer Guerra kam bereits nach Long Beach, zum ersten Rennen der Saison 1981. Bis dahin hatte er, bis auf einen Geradeaustest auf einem Flugplatzgelände, noch keine Formel-1-Erfahrung sammeln können. Der FA1B von Osella war allerdings heillos unterlegen, und Guerra war einer von fünf Fahrern, die sich nicht qualifizieren konnten.
Beim vierten Rennen in Imola gelang ihm dann schließlich die Qualifikation. Sein einziger Formel-1-Grand-Prix sollte jedoch nicht lange dauern. Das Feld hatte die schnelle Linkskurve Tamburello gerade zum ersten Mal passiert, die Strecke war noch nass, als Eliseo Salazar das Heck von Guerra touchierte, woraufhin er fast frontal in die Mauer krachte.
Er musste mit einer doppelten Knöchelfraktur aus dem Auto befreit werden. "So ist das Leben", sagt Guerra. "Ich habe keine weitere Chance in der Formel 1 bekommen. Anfang 1982 gab es eine große Finanzkrise in Argentinien, und es war nicht mehr möglich, einen passenden Sponsor zu finden."
Marco Apicella, Jordan, Grand Prix von Italien 1993, Monza; zurückgelegte Distanz: ca. 200 Meter
Apicella hatte bereits eine Karriere über fünf Saisonen in der europäischen Formel 3000 hinter sich und war mit Dome in Japan auf Siegkurs, als er das Angebot bekam, für Jordan den Grand Prix von Italien in Monza zu fahren. Ivan Capelli und Thierry Boutsen hatten das Cockpit bereits abgelehnt, und Eddie Jordan verlangte nicht viel Geld. Apicella bekam einen halben Testtag in Imola und reiste dann direkt nach Monza. Dort qualifizierte er sich als 23., obwohl er sich in den Lesmos von der Strecke gedreht hatte.
"Ich kann mich leider gut an diese Erfahrung erinnern", sagt er. "Ich war sehr aufgeregt. Gegen viele der anderen Fahrer war ich schon in der Formel 3000 gefahren, und irgendwie fühlte es sich an, als hätten sie nur auf mich gewartet. Es war ein großartiger Tag. Ich wusste aber auch bereits, dass ich nur dieses eine Rennen fahren würde, dementsprechend hoch war der Druck."
"Es war dennoch in Ordnung für mich, bis auf das Ergebnis! Ich kam vielleicht 200 Meter weit, bis mich jemand touchierte und die Lenkung brach. Ich musste schon vor der ersten Kurve anhalten. Ich weiß bis heute nicht, wer da in mich reingefahren ist. Ich will mir auch die Aufnahmen nicht noch einmal ansehen. Es ist immer noch schmerzhaft, wenn ich daran zurückdenke, obwohl ich in meiner Karriere sonst Glück hatte und woanders gute Ergebnisse erzielen konnte."
Ernst Loof, Veritas, Grand Prix von Deutschland 1953, Nürburgring-Nordschleife; zurückgelegte Distanz: 0 Meter
Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete Ernst Loof, ein ehemaliger BMW-Ingenieur und Motorradchampion, die Marke Veritas. Die finanzielle Situation war schwierig, aber Loof konnte in einer kleinen Werkstadt in der Nähe des Nürburgrings ein konkurrenzfähiges Formel-2-Chassis entwickeln, dass er auf den Namen "Meteor" taufte.
In einen von diesem konnte er sich 1953 im Alter von 46 Jahren als 31. für den Grand Prix von Deutschland qualifizieren. Juan Manuel Fangio übernahm gleich am Start die Führung, nachdem er den Polesitter Alberto Ascari überholt hatte – und während das Feld davon zog, blieb ein Auto auf der Startaufstellung zurück: Die Benzinpumpe von Loofs Meteor hatte den Geist aufgeben ...